Die deutsche Küche gilt als deftig, schwer und alles in allem recht uninspiriert. Und meiner Auffassung nach nicht ganz zu Unrecht, denn der rohe und achtlose Umgang mit Essen spiegelt sich schon in unserer Sprache wider. Begriffe aus der Welt der Nahrungsmittel werden hierzulande gerne benutzt, um sein Gegenüber zu beleidigen und zu diffamieren. Traurige Beispiele hierfür sind: Suppenkaspar, Hanswurst, Trauerkloß und beleidigte Leberwurst.
Was soll denn dieser Unfug? Wie beleidigt man denn bitte eine Leberwurst, indem man sie pauschal zusammen mit einer Blutwurst in einen Topf wirft? Wie kann eine Tomate treulos sein – oder hat eine Tomate Sie jemals betrogen, sagen wir, mit einer feurigen Paprika? Noch nie ist ein Früchtchen frech zu mir gewesen und noch nie, nie hat eine Zitrone, und war sie noch so sauer, mir gegenüber den nötigen Respekt vermissen lassen. Oder denken Sie an den Ausruf: „Das ist mir Wurst!“ Welch unpassende Phrase, um gleichgültiges Desinteresse auszudrücken! Wie kann der sublime Genuss einer rösch gebratenen Merguez aus zartem Lammfleisch einem Menschen mit einigermaßen funktionstüchtigen Geschmackspapillen einfach nur Wurst sein? „Das ist mir Haferschleim!“ ist ein Ausruf, den ich voll unterstützen kann. Aber Wurst ist mir eben nicht nur Wurst.
Andere Nationen haben da schon einen zärtlicheren, verbalen Umgang mit ihrem Essen. So säuselt der verliebte Pariser seiner Angebeten ein „Mon petit chou!“ ins Ohr. Übersetzt heißt das „Mein kleiner Kohl!“, und nicht wie man vermuten würde „Meine kleine Honigschnute!“ oder „Mein süßer Erdbeermund!“ Solch schnöde Banalität kann natürlich auch der plumpe teutonische Geist zusammenschustern. Seine Geliebte jedoch aus der Begriffswelt lagerfähigen Wintergemüses zu umwerben – dahinter steckt ein raffinierter, überraschender Geist. Denn warum sollten lediglich Süßspeisen zur Liebkosung taugen? Locken Sie die Dame Ihrer Gunst doch mal mit einem lasziv dahin gehauchten „Mein essigscharfes Senfgürklein!“ ins Bett. Ich habe mit „Du wildes, heißes Wirsing-Rouladchen!“ schon beachtliche Erfolge in der Frauenwelt gefeiert.

Der Franzose weiß eben, dass man ein Gericht eben auch verderben kann, wenn es sprachlich degradiert und profaniert wird. Natürlich ist ein Schweine-Kotelett mit Pilzen und Kartoffelpuffer ein Schweinekotelett mit Pilzen und Kartoffelpuffer. Aber erst als „Echine de porc et ses champignons des bois accompagnés d’une galette de purée maison“ erhält es wirkliche Raffinesse. Probieren Sie es aus: Essen Sie einmal ein halbes Hähnchen mit Pommes – und dann ein „Poulet rôti avec ses pommes de terre frites à la belge“. Sollten Sie den Unterschied nicht bemerken, verkriechen Sie sich wieder in die Höhle aus der Sie gekrochen sind.
Bei der Zubereitung des Essens gilt das Gebot des geschliffenen Wortes nicht minder. Man kann eben seine Ente roh zerlegen oder fein tranchieren, man kann ein Ei ohne Schale in heißes Wasser schmeißen oder es elegant pochieren. Gerade von der französischen Küche gibt es da viel zu lernen, denn sie hält ein Füllhorn an Fachbegriffen bereit, für die der deutsche Laie immer noch auf sein germanisches Grunzen umsteigen müsste. Da wird degrassiert, chatiert, degorgiert, dessechiert, pariert, pikiert und lardiert. „Lardieren“ heißt einen Hasenbraten mit Speckstreifen zu spicken. (Im Gegensatz zu „lädieren“, was soviel bedeutet, wie ein Tier aus größerer Höhe fallen zu lassen.)
 Damit ein Huhn im Ofen eine entsprechende Haltung einnimmt, wird es vom Küchen-Chef mit Hilfe eines Fadens zusammengeschnürt. Der Fachmann redet hier von „dressieren“, was sehr schön den derben Humor französischer Köche wiedergibt: Ist es doch äußerst schwierig ein Tier zu dressieren, dem man gerade den Kopf abgeschlagen und die Eingeweide aus dem Körper gerissen hat!
Damit ein Huhn im Ofen eine entsprechende Haltung einnimmt, wird es vom Küchen-Chef mit Hilfe eines Fadens zusammengeschnürt. Der Fachmann redet hier von „dressieren“, was sehr schön den derben Humor französischer Köche wiedergibt: Ist es doch äußerst schwierig ein Tier zu dressieren, dem man gerade den Kopf abgeschlagen und die Eingeweide aus dem Körper gerissen hat!
Viele dieser Begriffe kann man übrigens spielerisch in sein Privatleben übertragen. Mein Vorschlag: Sagen Sie zu Ihrer Frau an Ihrem Hochzeitstag: „Unsere Liebe mijotiert mit derselben Flamme wie eh und je.“ Das klingt doch viel schöner als „Unsere Ehe köchelt bei mäßiger Hitze im eigenen Saft.“ Die Liebe frankophoner Köche zur Sprache erklärt sich aus der Tatsache, dass die Zubereitung von Essen in Frankreich seit jeher als Teilgebiet der Poesie betrachtet wurde. Denken wir an den Koch Raginou, dem Edmond Rostand in dem tragisch-komischem Stück „Cyrano de Bergerac“ ein ewiges Denkmal gesetzt hat. 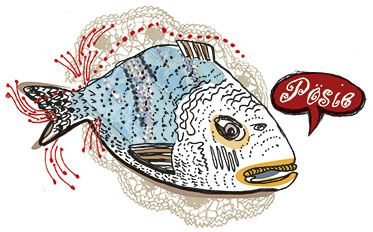 Für Raginou waren Kochrezepte derart kunstvolle Preziosen, dass er sie immer in Reimform verfasste und seine Liebe zur Poesie ging soweit, dass er einmal ein Nusstörtchen mit Fisch buk, bloß weil sich „Dorade“ nun mal so schön auf „Marmelade“ reimt.
Für Raginou waren Kochrezepte derart kunstvolle Preziosen, dass er sie immer in Reimform verfasste und seine Liebe zur Poesie ging soweit, dass er einmal ein Nusstörtchen mit Fisch buk, bloß weil sich „Dorade“ nun mal so schön auf „Marmelade“ reimt.
Noch heute gibt es Spitzenköche, deren Gerichte nicht nur kulinarische, sondern auch literarische Meisterwerke sind. Im Restaurant „Oxymore d’or“ (franz.: „Zum goldenen Oxymoron“) in Lyon darf der Gast ein literarisches Stilmittel von der Speisekarte auswählen, nach dessen Charakteristika dann gekocht wird. Ich habe dort eine wirklich vorzügliche alliterierende Geflügelterrine gegessen, deren Rezept noch heute goldumrahmt über meiner Messerbank hängt: „Gesalzene Gelatine geliert gut gewürzten Geflügelsud. Gebe gegrillte Gans, geschmolzenes Gemüse, galant garnierte gesottene Garnelen?…“ und so weiter.
Das lyrische Rezept ist als literarische Gattung in Deutschland fast vergessen. Überaus bedauerlich, ist doch bekannt, dass gerade die Klassik durch deutsche Köche entscheidend mitgeprägt wurde. Mehr noch, jeder halbwegs versierte Kunsthistoriker wird Ihnen bestätigen, dass die Hauptwerke der mitteleuropäischen Literatur fast ausnahmslos kulinarische Vorlagen hatten. Denken wir zum Beispiel an Parzival auf der „Suche nach dem heiligen Aal“ von Wolfsbarsch von Essensbach oder an „Erdbeeren aus Chili“ des schwäbischen Koches Heinrich von Dreist. Ohne „Emilia Sarotti“ von Gotthold Ephraim Dressing hätte die Aufklärung das Land der Dichter und Denker sicher nie erreicht. Dass diese Werke aus dem Kanon deutscher Geistesgeschichte rausgefallen sind, ist eine Schande, stellen sie doch erst das Fundament dar, auf dem sich eine eigenständige deutsche Literatur entwickeln konnte. Absolut unverständlich ist mir, dass sich unsere Schüler heute aber dennoch mit den Nachahmern und Nachäffern dieser großen Männer rumschlagen müssen, statt sich mit den Riesen zu beschäftigen, auf dessen Schultern literarische Zwerge wie Goethe oder Eichendorff standen.
Der übelste Plagiator deutscher Kochbücher war natürlich Friedrich Schiller. Nennen Sie mir ein einziges Werk, das nicht eindeutig von einem Kochbuch abgeschrieben wurde? „Der Wallnusskeim“, Hauptwerk des großen Salateurs Freiherr von Eichblatt, wurde sämtlicher Nährstoffe beraubt und schamlos zu einem nervtötenden pathologisch-pathetischen Possenspiel des Dreißigjährigen Krieges umgereimt. Das höchst lehrreiche Sinnstück über Resteverwertung in der Küche „Farfalle und Griebe“ von Christian Gallert wurde zu einer kleinbürgerlichen Schmonzette verwurstet. Am schlimmsten traf es natürlich Wilhelm Tell. Wie oft wäre ich gerne schon im Theater aufgesprungen und hätte gezürnt: „Du lügst, Friedrich Schiller! Dieser Apfel wurde nicht mit Pfeilen gespickt, sondern mit glasierten Mandelspitzen, denn so steht es geschrieben bei Johann Gottlieb Früchtegott!“ Dass diesem Schiller mit der gleichnamigen Schillerlocke auch eine Spezialität aus geräuchertem Dornhai vermacht wurde, erfüllt mich immer wieder mit heiligem Zorn. Hauptopfer dieser ruchlosen Machenschaften war Johann Sebastian Glocke, höchst ehrwürdiger Koch zum „Geleimten Krug“ in Leipzig. Kennen Sie wahrscheinlich nicht. Natürlich nicht, denn warum sollte man sich eines Genies erinnern, das Meisterwerke erschuf wie „Ode an den Sauerbraten“, „Sauerrahms Nachtlied“ oder „Ballade vom standhaften Soufflé“. Warum sollte man über die Schönheit eines in daktylischen Hexametern verfassten Rezeptes für griechischen Bauernsalat meditieren? Da lässt man lieber seine verzogene Brut unter halbdebilem Seufzen Fritze Schillers „Lied an die Glocke“ daherstammeln – natürlich auch geklaut. Dieses Werk wurde bereits 1785 unter dem Titel „Lied von der Flocke“ von Glocke geschaffen, also fünf Jahre vor Erstauflage von Schillers armseligem Schüttelreim-Sammelsurium. Vielleicht ist die Ähnlichkeit dieser beiden Werke nur Zufall, doch existiert tatsächlich eine Rechnung, die beweist, dass Schiller im „Geleimten Krug“ 1789 eine Schweinshaxe gegessen hat. (Und die Hax’n hat dieser Kretin übrigens bis heute nicht bezahlt.)
Deshalb an alle Studienräte da draußen: Zerreißen Sie Ihre Schulbücher! Das nun folgende Gedicht legte den Grundstein für die deutsche Klassik, und nicht das Gekritzel dieses schwindsüchtigen Marbacher Schmierfinken. Und wenn Sie dann immer noch Herrn Schiller einem Glocke vorziehen, hat weder die deutsche Küche noch die deutsche Sprache einen Ignoranten wie Sie verdient.
Z-U-T-A-T-E-N:
Äpfel drei
Viermal Ei
Mehl, ganz fein
Süßen Wein
Butter, frisch
Keinen Fisch
Mit Anis
Wird es fies
Nimm doch Zimt
Und es stimmt.
Fest gemauert in die Küche
Steht der Herd aus Lehm gebrannt.
Heute muss die Flocke werden,
Frisch, Ihr Köche, seid zur Hand!
Von der Stirne heiß
Rinnen muss der Schweiß.
Soll der Gast die Plätzchen loben,
Sonst landen sie im Schweinekoben.
Nehmet Mehl vom Weizenkorne,
Fein gemahlen muss es sein,
Türme das zu einem Berge,
Schlage Butter nun hinein.
Zucker! Zimt! Herbei!
Apfel! Wein! Und Ei!
Knete nun die Flockenspeise,
Mürbe nach der rechten Weise!
Bevor das Backen kann beginnen
Bedarf es noch der rechten Form.
Der Teig getrennt in kleine Teile,
Aus jedem macht ein kurzes Horn.
In den Ofen hinein!
Stellt die Backzeit ein!
Damit erfülle sich die Luft
Mit dem weihnachtlichen Duft.
Wie sich schon die Plätzchen bräunen,
Dieses Stäbchen steck ich rein:
Sehn wir Krümel dort nun hängen,
Wird das Backwerk fertig sein.
Jetzt Gesellen nur,
Prüft mir die Glasur.
Dass das Mürbe mit dem Weichen
Sich vereint zum guten Zeichen.
Bis die Flocke sich verkühlet,
Lasst die strenge Arbeit sein!
Und den Rest vom Küchenwein
Haut Euch in die Köpfe rein.
Winkt der Sterne Licht,
Ledig aller Pflicht,
Kann man einen Bissen wagen
Und zum Herrgott „Danke“ sagen!
Hier wird der aufmerksame Leser sicher fragen: „Wollten Sie, Herr Weber, nicht ein Buch über unmögliche Gerichte schreiben?“ Die Antwort ist ganz einfach: Bedauerlicherweise hat Glocke in seinem schöpferischen Drange das Backpulver vergessen. Viele Kunsthistoriker sind deshalb der Ansicht, dass diese Plätzchen von Glocke nie gebacken worden sein können. Mag sein, doch schmälert dies den dichterischen Genuss und die epochale Wirkung für die deutsche Geistesgeschichte nicht im Geringsten.
Dieses Rezept stammt aus dem Buch:
„RAGOUT VOM MAMMUT – 12 aberwitzige Kochgeschichten“
Autor: Philipp Weber, Illustration: Inka Meyer
Käuflich zu erwerben im TreTorri-Shop, ISBN 978-3-944628-21-9


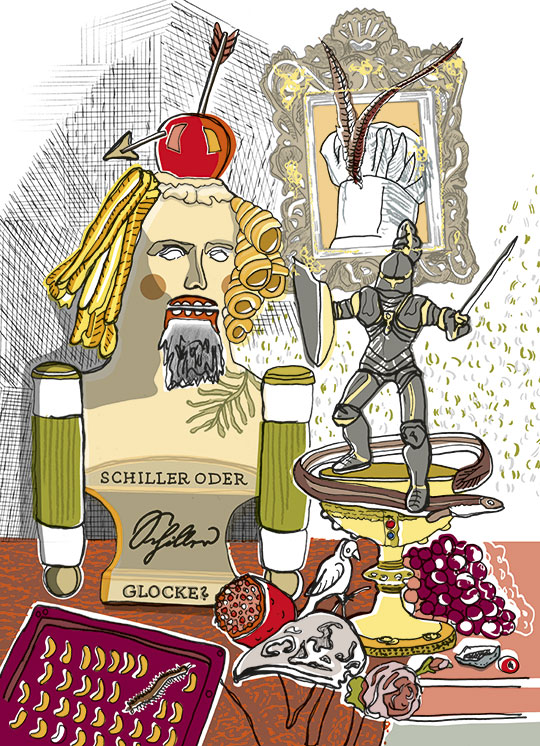
Dajana – 2. Januar 2015, 19:52 Uhr
Einfach nur köstlich……mein lieber Herr Weber…hab sie in Plauen genießen dürfen.Ich wünsch mir dass sie den östlichen Teil von Deutschland viel mehr beköstigen.DANKE!!!